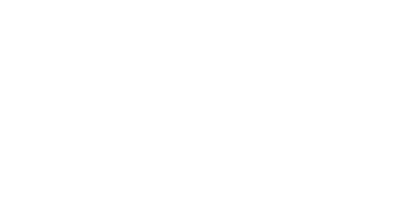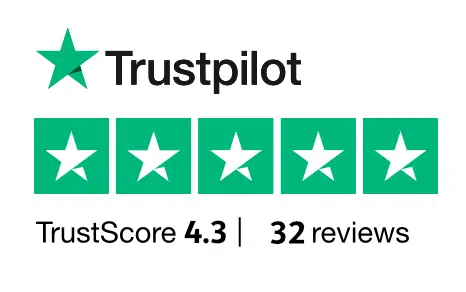Hier findest Du das umfangreichste Online Startup Lexikon im deutschsprachigen Raum, das ich über mehrere Jahre für meine Kunden geschrieben habe. Es enthält über 1.000 Begriffe aus dem Startup-Alltag, die Du samt Abkürzungen nachschlagen kannst.
Wenn Du Fehler entdecken solltest oder eigene Begriffe hast, die Du gern aufgenommen im Startup Lexikon sehen würdest, schreibe mir gern eine Mail.
Luise-Ullrich-Str. 20
D-80636 München
Tel 089-2488613-60
Email
Rheinsberger Str. 76
D-10115 Berlin
Tel 030-5093089-30
Email